|
| |
Der Landkreis Allenstein
 Der
Landkreis Allenstein hat eine Flächengröße von 1.302,67 qkm und 57.150
Einwohner, das sind 43,9 auf 1 qkm. Er erstreckt sich zu beiden Seiten des
Oberlaufs der Alle. Die Westgrenze wird von der oberen Passarge gebildet. Da das
Kreisgebiet zur Masurischen Seenplatte gehört, ist es reich an Hügeln, Bergen
und Kuppen, Senken und Seen. Die größten von ihnen sind der zwischen Wäldern
eingebettete Lansker See und der an der Südgrenze liegende Große Plautziger See.
Waldungen sind hauptsächlich im Südzipfel des Kreises vertreten: der
Lanskerofener, der Ramucker und der Purdener Forst. In ihnen herrschen
Nadelholzbestände vor. Geographisch gehört das Kreisgebiet zu Masuren,
geschichtlich zum Ermland. Es war jahrhundertelang von Prußen besiedelt. Im
Gebiet der oberen Alle lagen die prußischen Landschaften Gudicus und Bertingen,
an sie erinnern die Ortschaften Göttkendorf und Bertung. Außerdem gibt es
zahlreiche Orts- und Flurnamen prußischen Ursprungs: Darethen, Diwitten,
Gilbingsee, Gillau, Jadden, Purden, Schaustern, Skaibotten, Windtken und viele
andere. Im 14. Jahrhundert setzte die Besiedlung mit Deutschen ein, und als
später der Zustrom deutscher Siedler aufhörte, nahm die Landesherrschaft
Masowier auf, „die mit der Einverleibung ihres Herzogtums in das Königreich
Polen nicht zufrieden waren". Aus diesen Gründen setzte sich die Bevölkerung des
südlichen Ostpreußen aus Prußen, Deutschen und eingewanderten Masowiern
zusammen, die im Laufe der Jahrhunderte zum Stamm der Masuren zusammenwuchs;
diese haben sich stets als Deutsche gefühlt. Trotz der nur mittelmäßigen Böden
im Kreise hatte sich eine bodenständige landwirtschaftliche Bevölkerung
gebildet; bäuerliche Mittelbetriebe herrschten vor; größere Güter waren weniger
vertreten, es seien genannt die Domäne Posorten (1931: 577 ha), das staatliche
Fischereigut Daumen (385 ha), die privaten Güter Adlig Bergfriede (332 ha),
Paulshof (334 ha), Klein-Trinkhaus (656 ha), Groß-Bartelsdorf (514 ha), Kellaren
(307 ha), Schönau (718 ha), Piestkeim (269 ha). Der
Landkreis Allenstein hat eine Flächengröße von 1.302,67 qkm und 57.150
Einwohner, das sind 43,9 auf 1 qkm. Er erstreckt sich zu beiden Seiten des
Oberlaufs der Alle. Die Westgrenze wird von der oberen Passarge gebildet. Da das
Kreisgebiet zur Masurischen Seenplatte gehört, ist es reich an Hügeln, Bergen
und Kuppen, Senken und Seen. Die größten von ihnen sind der zwischen Wäldern
eingebettete Lansker See und der an der Südgrenze liegende Große Plautziger See.
Waldungen sind hauptsächlich im Südzipfel des Kreises vertreten: der
Lanskerofener, der Ramucker und der Purdener Forst. In ihnen herrschen
Nadelholzbestände vor. Geographisch gehört das Kreisgebiet zu Masuren,
geschichtlich zum Ermland. Es war jahrhundertelang von Prußen besiedelt. Im
Gebiet der oberen Alle lagen die prußischen Landschaften Gudicus und Bertingen,
an sie erinnern die Ortschaften Göttkendorf und Bertung. Außerdem gibt es
zahlreiche Orts- und Flurnamen prußischen Ursprungs: Darethen, Diwitten,
Gilbingsee, Gillau, Jadden, Purden, Schaustern, Skaibotten, Windtken und viele
andere. Im 14. Jahrhundert setzte die Besiedlung mit Deutschen ein, und als
später der Zustrom deutscher Siedler aufhörte, nahm die Landesherrschaft
Masowier auf, „die mit der Einverleibung ihres Herzogtums in das Königreich
Polen nicht zufrieden waren". Aus diesen Gründen setzte sich die Bevölkerung des
südlichen Ostpreußen aus Prußen, Deutschen und eingewanderten Masowiern
zusammen, die im Laufe der Jahrhunderte zum Stamm der Masuren zusammenwuchs;
diese haben sich stets als Deutsche gefühlt. Trotz der nur mittelmäßigen Böden
im Kreise hatte sich eine bodenständige landwirtschaftliche Bevölkerung
gebildet; bäuerliche Mittelbetriebe herrschten vor; größere Güter waren weniger
vertreten, es seien genannt die Domäne Posorten (1931: 577 ha), das staatliche
Fischereigut Daumen (385 ha), die privaten Güter Adlig Bergfriede (332 ha),
Paulshof (334 ha), Klein-Trinkhaus (656 ha), Groß-Bartelsdorf (514 ha), Kellaren
(307 ha), Schönau (718 ha), Piestkeim (269 ha).
Die im östlichen Kreisteil gelegene Stadt Wartenburg ist
zweimal gegründet worden. Um das Jahr 1325 errichtete der Bistumsvogt Friedrich
von Liebenzell in der prußischen Landschaft Gundelauken auf einer Anhöhe am
Nordufer des Wadangsees das Wacht- und Wildhaus „Wartenberg". In seinem Schutz
entstand die Stadt Wartenburg. Burg und Stadt wurden im Winter 1353/1354 durch
die Litauer ganz zerstört. An ihrer Stätte wurde noch im 14. Jahrhundert das
Dorf Altwartenburg gegründet; seine Kirche wurde 1582 geweiht, 1889/1893 ist sie
umgebaut worden. Noch in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts nannte der
Volksmund Altwartenburg „die alte Stadt".
Der ermländische Bischof Johannes Stryprock gründete ostwärts
der alten Siedlung am Zusammenfluß von Kirmes und Pissa, die danach die Wadang
bilden, die neue Stadt Wartenburg, 1364 erteilte er ihr die Handfeste. Zu dem
180 Hufen, später auf 225 Hufen vergrößerten Stadtgebiet kam 1482 das wüst
gewordene Dorf Reuschhagen mit 45 Hufen hinzu, so daß Wartenburg über einen
großen Landbesitz verfügte. Noch in jüngster Zeit war ihr Stadtwald mit drei
Seen 6.000 Morgen groß. In der Nordostecke der Stadt lag die bischöfliche Burg,
an drei Seiten durch Gewässer geschützt und einbezogen in die Stadtbefestigung.
Sie bestand aus einem Haupthaus und einem Nebenflügel als Wirtschaftshaus. In
Hauptflügel amtierte der Burggraf, der bis 1772 Stadt und Amt Wartenburg als
bischöfliche Domäne verwaltete. Nach dem großen Brand von 1798 wurde das
Haupthaus 1826 für die evangelische Volksschule umgebaut. Der alte Stadtkern lag
auf einer Insel, die durch die Wadang,
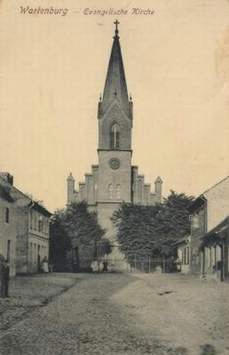 ihren
künstlichen Nebenarm und den Mühlenteich gebildet worden war. Das im
rechtwinkligen Grundriß angelegte Straßennetz schloß den Markt ein. Die
Stadtbefestigung, das Rathaus mitten auf dem Markt und die Pfarrkirche St. Anna,
eine dreischiffige, chorlose Hallenkirche, entstanden in der zweiten Hälfte des
14. Jahrhunderts. Das Rathaus, das mehrmals zuletzt 1798 abgebrannt ist, erhielt
im 19. Jahrhundert seine jetzige Gestalt. Auch die Pfarrkirche, 1798
ausgebrannt, wurde mit einer welschen Haube und Laterne versehen, der Choranbau
kam erst 1894 hinzu. Die Stadtmauer und die drei Tore wurden nach 1800
abgetragen, geringe Reste der Mauer an der Südseite sind in Häusern verbaut
worden. Das 1380/1390 erbaute Franziskanerkloster, mit Schloß und Stadt 1414 von
den Polen eingeäschert, entstand von neuem, ging in der Reformation ein, kam
1597 an die Bernhardiner, wurde 1810 aufgehoben und fiel an den Staat, der in
dem alten Kloster eine Strafanstalt einrichtete. Als 1846 ein Brand das
dreiflügelige Gebäude zerstörte, wurde es neu erbaut. Die Klosterkirche St.
Andreas ist erhalten geblieben und „eine der wenigen aus dem Mittelalter
überkommenen Klosterbauten im Ordensland von besonderer Bedeutung". Sie dient
dem katholischen Gottesdienst. Die evangelische Kirche, „Pastorenkirche"
genannt, wurde 1871 geweiht; zu ihrem Bau spendeten auf Bitten des Pfarrers Haß
mehrere tausend Pfarrer aus ganz Deutschland je einen Taler. Wartenburg, eine
Kleinstadt mit Ackerbürgern, Mühlenbetrieben, Brauereien und einer
Zigarrenfabrik, ist wirtschaftlicher Mittelpunkt nur der näheren Umgebung. In
alter Zeit hatte sie Bedeutung durch Garn- und Leinenhandel. 1872 erhielt die
Stadt Anschluß an die Eisenbahnstrecke
Allenstein -
Insterburg. 1928 wurde das Vorwerk Terka eingemeindet. 1939 hatte die Stadt
5.843 meist katholische Einwohner. Im Ersten Weltkrieg erlitt Wartenburg keine
sonderlichen Verluste. Im Januar 1945 lagen die Stadt und ihre Umgebung im
Kampfgebiet. Wartenburg wechselte dreimal den Besitzer. Als Ende Januar 1945 die
letzten Orte im nördlichen Kreisgebiet aufgegeben werden mußten, fiel Wartenburg
am 31. Januar in die Hände der Russen. Am 1. Februar war der gesamte Kreis in
sowjetischer Hand. ihren
künstlichen Nebenarm und den Mühlenteich gebildet worden war. Das im
rechtwinkligen Grundriß angelegte Straßennetz schloß den Markt ein. Die
Stadtbefestigung, das Rathaus mitten auf dem Markt und die Pfarrkirche St. Anna,
eine dreischiffige, chorlose Hallenkirche, entstanden in der zweiten Hälfte des
14. Jahrhunderts. Das Rathaus, das mehrmals zuletzt 1798 abgebrannt ist, erhielt
im 19. Jahrhundert seine jetzige Gestalt. Auch die Pfarrkirche, 1798
ausgebrannt, wurde mit einer welschen Haube und Laterne versehen, der Choranbau
kam erst 1894 hinzu. Die Stadtmauer und die drei Tore wurden nach 1800
abgetragen, geringe Reste der Mauer an der Südseite sind in Häusern verbaut
worden. Das 1380/1390 erbaute Franziskanerkloster, mit Schloß und Stadt 1414 von
den Polen eingeäschert, entstand von neuem, ging in der Reformation ein, kam
1597 an die Bernhardiner, wurde 1810 aufgehoben und fiel an den Staat, der in
dem alten Kloster eine Strafanstalt einrichtete. Als 1846 ein Brand das
dreiflügelige Gebäude zerstörte, wurde es neu erbaut. Die Klosterkirche St.
Andreas ist erhalten geblieben und „eine der wenigen aus dem Mittelalter
überkommenen Klosterbauten im Ordensland von besonderer Bedeutung". Sie dient
dem katholischen Gottesdienst. Die evangelische Kirche, „Pastorenkirche"
genannt, wurde 1871 geweiht; zu ihrem Bau spendeten auf Bitten des Pfarrers Haß
mehrere tausend Pfarrer aus ganz Deutschland je einen Taler. Wartenburg, eine
Kleinstadt mit Ackerbürgern, Mühlenbetrieben, Brauereien und einer
Zigarrenfabrik, ist wirtschaftlicher Mittelpunkt nur der näheren Umgebung. In
alter Zeit hatte sie Bedeutung durch Garn- und Leinenhandel. 1872 erhielt die
Stadt Anschluß an die Eisenbahnstrecke
Allenstein -
Insterburg. 1928 wurde das Vorwerk Terka eingemeindet. 1939 hatte die Stadt
5.843 meist katholische Einwohner. Im Ersten Weltkrieg erlitt Wartenburg keine
sonderlichen Verluste. Im Januar 1945 lagen die Stadt und ihre Umgebung im
Kampfgebiet. Wartenburg wechselte dreimal den Besitzer. Als Ende Januar 1945 die
letzten Orte im nördlichen Kreisgebiet aufgegeben werden mußten, fiel Wartenburg
am 31. Januar in die Hände der Russen. Am 1. Februar war der gesamte Kreis in
sowjetischer Hand.
In Hirschberg, 6 km südlich Wartenburg, lag bis zum Anfang
des 19. Jahrhunderts eine bischöfliche Burg, die als „eine der schönsten" galt.
Bei Tengutten, nordöstlich Wartenburg, sind Überreste von „Pfahlbauten" entdeckt
worden. Südlich Allenstein liegt die 1886 eröffnete Provinzial- und
Pflegeanstalt Kortau mit einem 227 ha großen landwirtschaftlichen Betrieb. Die
bei Allenstein gelegene Lungenheilstätte Frauenwohl wurde 1907 in Betrieb
genommen. Bei dem Gut Adlig Bergfriede fand am 3. Februar 1807 ein Gefecht
zwischen Franzosen und Russen um die Allebrücke statt. Napoleon soll damals bei
der gewaltigen „Napoleonseiche" gestanden und den Kampf gelenkt haben; es
handelt sich um eine der größten Eichen Ostpreußens, sie hatte schon vor 70
Jahren einen Umfang von 9,85 m. Bei Darethen, 10 km südlich Allenstein, breitet
sich der inselreiche Wulpingsee aus. Er gehörte wie der Ustrich- und der Lansker
See und die Jugendherberge Lalka (Klein-Ramuck) zu den besuchtesten und
beliebtesten Ausflugszielen im Kreise Allenstein.
Unweit der Westgrenze des
Kreises liegt der Wallfahrtsort Dietrichswalde; hier soll 1877 die Jungfrau
Maria an einem Baum außerhalb des Dorfes mehreren Gläubigen erschienen sein. Die
dortige katholische Kirche ist zum Teil mit mittelalterlichen Umfassungsmauern
1884 neu erbaut worden. Das Vesperbild in der Vorhalle stammt aus der zeit um
1430, das granitene Weihwasserbecken aus dem 15. Jahrhundert.
Im Dorfe Gelguhnen
in der Ramucker Forst wurden 1782 eine staatliche Pottaschensiederei und eine
Glashütte mit Glasschleiferei angelegt. Die Glashütte bestand bis ins 19.
Jahrhundert.
Patenschaftsträger für den Landkreis Allenstein ist der
Landkreis Osnabrück.
|
 |
Quellen:
Foto Hohes Tor: Archivmaterial;
Wappen: Das Ostpreußenblatt (www.Ostpreussenblatt.de),
2000;
Siegel: Kreisgemeinschaft Allenstein-Land (www.allenstein-landkreis.de/),
2004;
Postkarte: 10000
Ansichtskarten, Deutschland um 1900 im Bild, Stichwort "Wartenburg",
The Yorck Project, Gesellschaft für Bildarchivierung, Berlin, 2001;
Text: Guttzeit: Ostpreußen in 1440 Bildern, Verlag Rautenberg, 1972-1996,
Seite 62-66 |
_____________________________
weitere Informationen:
Der Landkreis Allenstein:
www.allenstein-landkreis.de/.
|